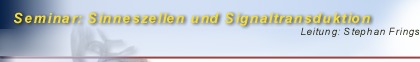 |
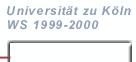 |
 |
Inhaltsverzeichnis: Die Geschmacksqualitäten "Süss" und "Sauer"Jeder hat sie schon einmal feststellen können: Die Geschmacksqualitäten Süss und Sauer. Sei es beim Auslutschen einer frischen Zitrone oder beim Verzehr einer Schokoladentorte. Verschiedenste Nahrungsmittel können diese Geschmäcker in den unterschiedlichsten Abstufungen hervorrufen. Kaum einer ist sich jedoch beim Genuss eines Stücks Schokolade bewusst, dass hinter der Identifizierung des Geschmacks als süss eine komplizierte Physiologie steckt. Innerhalb des Seminars zur Sinnesphysiologie habe ich versucht ein wenig Licht hinter diese Stoffwechselvorgänge zu bringen. Ich hoffe es ist mir einigermassen gelungen und bitte eventuelle Unvollständigkeiten zu entschuldigen. Auftretende Fragen können an mich, den Autor, gerichtet werden: mgeupel@yahoo.de |
 |
| |
Reizbedingungen für Untersuchungen | ||
|
|
|
||
| |
Schwellenwerte zur Geschmacksbestimmung | ||
|
|
Recognition Treshold (Minimalschwelle): Konzentration, die ein Stoff haben muß, um spezifisch erkannt zu werden. Bei extrem tiefen Temperaturen (0°C) und bei sehr hohen Temperaturen (50°C) nimmt die Geschmacksempfindlichkeit ab, d.h. die Schwellenkonzentrationen steigen. Beispiele:
Adaptation: Hält man eine Schmecklösung über längere Zeit im Mund nimmt die Geschmacksempfindlichkeit mit der Zeit ab. Man könnte sagen, daß man sich an den Reiz gewöhnt. Dieser Vorgang hängt wohl vornehmlich nicht mit Vorgängen an Rezeptoren, sondern mit zentralnervösen Prozessen zusammen.
|
||
| top | Der süsse Geschmack | ||
|
Der süsse Geschmack wird hauptsächlich durch organische Verbindungen hervorgerufen. Die grösste Rolle spielen hierbei natürlich die Zucker und Zuckerderivate aber auch Alkohole und Glykole können süss schmecken. Sogar einige anorganische Verbindungen, namentlich Blei- und Berylliumsalze, schmecken süss. Leider ist es noch nicht gelungen ein System in dieBeziehungen zwischen chemischer Molekülstruktur und Süssgeschmack zu bringen. Bis jetzt kann man nur sagen, dass alle süss schmeckenden Moleküle zwei polare Substituenten haben. Eine elektrophile und eine nucleophile Gruppe. Auch die Grössenverhältnisse spielen eine Rolle. So kann bei manchen Homologen der Geschmack mit zunehmendem Molekulargewicht von süss nach bitter umschlagen. Des weiteren ist die räumliche Anordnung bestimmter Gruppen von entscheidender Bedeutung. Kleine Veränderungen können die Geschmacksqualität entscheidend beeinflussen.
D- Phenylalanin schmeckt beispielsweise süss, während L-Phenylalanin bitter schmeckt. Ausserdem schmecken frisch bereitete Lösungen von a-D-Glucose stärker süss, als entsprechende Konzentrationen von b-D-Glucose. Die räumliche Anordnung ist wahrscheinlich wegen dem Bindungsareal am Rezeptor so wichtig. Diese ist eine hydrophobe Tasche, die ebenfalls eine elektro -und eine nucleophile Gruppe besitzt, welche es den "Süssmolekülen" ermöglicht zu binden. Wenn ein Molekül gebunden hat soll ein Aktionspotential ausgelöst werden, bzw. eine Neurotransmitterausschüttung stattfinden, damit der Reiz ans Gehirn weitergegeben werden kann, wo er dann entschlüsselt wird. Eine wichtige Rolle spielen dabei wahrscheinlich sogenannte G-Proteine und cAMP. Das G-Protein, genauer seine Untereinheit a-Gustducin, wird aktiviert, wenn ein Molekül an einen "Süssrezeptor" bindet. (a-Gustducin ist homolog zu Transducin, eine Proteinuntereinheit, die in Photorezeptoren eine Rolle bei dem Auslösen von Aktionspotentialen spielt) Es gibt nun zwei Möglichkeiten, wie durch a-Gustducin nun eine Depolarisation ausgelöst wird. Die erste, relativ sichere Theorie, ist, dass a-Gustducin eine Adenylatzyklase aktiviert, welche für die Herstellung von cAMP verantwortlich ist. Camp wiederum blockiert dann direkt oder indirekt K+-Ionen-Kanäle welche zur Aufrechterhaltung von Ruhepotentialen verant-wortlich sind. Kalium-Ionen können nicht mehr ausströmen; es kommt zur Depolarisation. Eine andere Theorie ist, dass, betrachtet man Homologie von a-Gustducin zu Transducin, eine Phosphodiesterase aktiviert wird. Diese Enzyme bewirken den Abbau von zyklischen Nucleotiden, und somit auch den von cAMP. Es wäre also möglich das a-Gustducin die "Süss-Erkennung" durch einen Konzentrationsabfall von cAMP induziert. Dagegen spricht jedoch, dass man beobachtet hat, dass, wenn man geschmackssensorische Zellen mit Zuckern stimuliert, es zu einem Anstieg der cAMP-Konzentration kommt. CAMP spielt also auf jeden Fall eine entscheidende Rolle! Ein weiterer möglicher Stoffwechselweg beinhaltet das Molekül IP3. Stimuliert man Rattenzellen mit Kunstzuckern, wie Saccharin, steigt die IP3-Konzentration.Das wiederum führt dazu, dass intrazelluläre Calciumspeicher geöffnet werden. Wodurch es zu einer Transmitterausschüttung oder einer Depolarisation kommen kann. Es gibt noch eine Reihe weiterer hypothetischer Stoffwechselwege, die für eine Reizweiterleitung verantwortlich sein könnten, doch auch hier ist es bis jetzt noch nicht gelungen ein befriedigendes und allgemeingültiges System aufzustellen.
|
|||
| top | Der saure Geschmack | ||
|
Membranmechanismen In der Membran der Mikrovilli der Rezeptor-Zellen konnten spezielle "Sauer-Rezeptor-K+-Kanalproteine" festgestellt werden. Durch sie verlässt unter Ruhebedingungen K+ die Zelle. Saure Valenzen, d.h. H+-Ionen, blockieren diese Kanäle , wodurch es zur Depolarisation kommt. Eine weitere Proteinform sind H+/Na+-Austauscherkanäle. Bindet Wasserstoff an diese Kanäle wird für jedes Ion ein Na+-Ion in die Zelle transportiert. Es kommt zur Depolarisation.
|