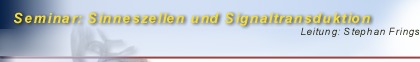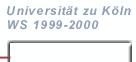|
Das
Membranpotential eines Photorezeptors bei Licht und Dunkelheit |
|
|
Die Außenmembran des Innensegmentes ist für K+-Ionen recht durchlässig,
und da die Konzentration der K+- Ionen in der Zelle höher ist als außerhalb,
diffundieren die K+- Ionen entlang des Konzentrationsgefälles von innen
nach außen. Dabei transportieren sie positive Ladungen nach außen, sodaß
das Innere der Zelle deutlich negativer gegenüber der Außenseite geladen
wird. Die Außenmembran des Außensegments besitzt Na+-Kanäle, die aber
auch Ca2+ leiten. Na+ und Ca2+ sind außerhalb der Zelle höher konzentriert
als innerhalb und strömen durch die Kanäle in die Zelle. Damit werden
jetzt wieder positive Ionen in die Zelle befördert und die negative Ladung
innerhalb der Zelle sinkt auf -40 mV. Diese Stromschleife, die hauptsächlich
von den nach innen strömenden Na+ und den nach außen strömenden K+ Ionen
gebildet wird, heißt Dunkelstrom (Abb. 1). Die Ca2+ -Ionen spielen beim
Dunkelstrom keine große Rolle, ihre Bedeutung wird später erläutert.
 |
|
Abb. 1
Zwei Photorezeptoren schematisch. Links im Dunkeln mit Dunkelstromschleife,
rechts im Hellen mit Photostrom.
aus:"Signaltransduktion in Sehzellen", F. Müller & U. B. Kaupp in
Naturwissenschaften 85, 49-61 (1998) Springer
|
Wird der Photorezeptor von Licht gereizt,schließen sich die Na+/Ca2+
-Kanäle. Damit wird der Einstrom dieser Ionen gestoppt und die negative
Ladung innerhalb der Zelle steigt, da jetzt nur noch K+- Ionen am Innensegment
nach außen strömen und das positive Ladungsdefizit im Inneren der Zelle
nicht mehr von einströmenden Na+- Ionen kompensiert wird. Die Zelle hyperpolarisiert
und weist ein Membran-potential von -70 mV bei Belichtung auf. Diesen
einseitigen Strom nennt man Photostrom.
Durch passive elektrische Leitung wird die Spannungsänderung bis zur Synapse
geleitet. Dort öffnen sich spannungsabhängige Ca2+-Kanäle. Bei hoher Ca
2+-Konzentration entlassen Vesikel, die in der präsynaptischen Membran
liegen, den Transmitter Glutamat in den synaptischen Spalt. Die Hyperpolarisation
hört auf, Ca2+-Ionen werden über Austauscher wieder aus der Zelle gepumpt.
Die Zelle ist also bei Dunkelheit aktiv, da sie depolarisiert ist und
gleichzeitig Transmitter ausschüttet. Eine Na+/K+- Pumpe sorgt dafür,
daß sich während des Dunkelstroms kein Na+ in der Zelle anhäuft und kein
K+- Mangel in der Zelle entsteht .
|
| top |
Der
Botenstoff cGMP der Lichtreaktion |
|
|
cGMP ist das Molekül, das die Na+/Ca2+- Kanäle und damit das Membranpotential
bzw. die Aktivität der Zelle kontrolliert. Ist die Konzentration an cGMP
in der Zelle hoch, bindet es an die Kanäle und öffnet sie dadurch. Eine
niedrige cGMP Konzentration veranlaßt das Lösen der cGMP Moleküle von
den Kanälen, wodurch sie sich schließen.
 |
|
Abb. 2:
Ein Na+/Ca+2+-Kanal in der Außenmembran des Außensegments. Links
mit hoher cGMP Konzentration, rechts mit niedriger cGMP Konzentration
in der Zelle.
aus:"Signaltransduktion in Sehzellen", F. Müller & U. B. Kaupp in
Naturwissenschaften 85, 49-61 (1998) Springer
|
Die Enzymkaskade, die nun die cGMP Konzentration kontrolliert und von
einem Lichtreiz akiviert wird, wird von Enzymen gesteuert, die jeweils
einen Zyklus bestehend aus Aktivität und Inaktivität, bzw. Regen- eration
durchlaufen. Diese Zyklen greifen ineinander, und besonders wichtig ist
die exakte zeitliche Abstimmung zwischen Aktivität und Inaktivierung dieser
Enzyme, damit die Enzymkaskade weder zu lange anhält und eine zu große
Wirkung erzielt, noch zu kurz ist um ausreichend Wirkung zu erzeugen.
|
| top |
Die
Enzymkaskade |
|
|
Sie startet beim Rhodopsin. Rhodopsin besteht aus einem Proteinanteil,
dem Opsin und einem Chromophor, dem 11-cis Retinal. Das 11-cis Retinal
besitzt eine Abfolge von konjugierten Doppelbindungen, die es befähigen
Licht zu absorbieren. Durch die Bindung an das Opsin wird sein Absorbtionsmaximum
in den sichtbaren Bereich des Wellenspektrums verschoben. Absorbiert nun
das Retinal einen Lichtquant, wird es räumlich in die all-trans Form umgewandelt.
Dadurch paßt es nun nicht mehr an das Rhodopsin und trennt sich davon.
All dies hat Auswirkungen auf das Rhodopsin (R), welches sich daraufhin
auch räumlich verändert und zum enzymatisch aktiven Rhodopsin (R*) wird.
Ein aktives Rhodopsin aktiviert nun bis zu 3000 Transducinmoleküle, bevor
es von einer Rhodopsinkinase phosphoryliert wird und anschließend von
Arrestin (A) gebunden wird. Arrestin verhindert gebunden an aktives Rhodopsin
einfach nur eine Aktivierung von Transducin durch das aktive Rhodopsin.
Nach einer Zeit fällt das Arrestin wieder vom Rhodopsin ab, wobei 11-cis
Retinal, welches im Pigmentepithel aus all-trans Retinal regeneriert wurde,
sich wieder an das Retinal anlagert. Dadurch ist wieder ein aktivierbares
Rhodopsin regeneriert worden.
Transducin (T) gehört zur Familie der GTP-bindenden Proteine oder G-Proteine.
Es besteht wie alle G-Proteine aus drei unterschiedlichen Untereinheiten,
die a , b und g genannt werden. Die a-Untereinheit bindet im inaktiven
Zustand GDP. Das aktive Rhodopsin tauscht nun GDP gegen GTP an der a-Untereinheit
des Transducins aus, wobei das Transducin sich von der a-Untereinheit
trennt. So zerfällt das Transducin in die aktive a-Untereinheit, die GTP
gebunden hat (T* GTP) und die b-g-Untereinheit (T b-g ). Ein aktives Transducin
(T* GTP) spaltet nun eine Phosphodiesterase (PDE) und macht sie dadurch
Enzymatisch aktiv. Die Phosphodiesterase besteht aus einer a, einer b
und zwei g-Untereinheiten. Enzymatisch aktiv ist nur der a-b-Komplex (PDE
a-b), die beiden g-Untereinheiten (PDE g) wirken hemmend auf a und b.
Transducin bindet nur eine g-Untereinheit, die von der PDE somit getrennt
wird, was aber schon ausreicht, um die Hemmung von der a- zusammen mit
der b-Untereinheit aufzuheben. Aus der a-Untereinheit des Transducins,
gebunden mit GTP (T* GTP), ist nun durch die Bindung mit der g-Untereinheit
der PDE (PDE g ), ein Transducin-PDE-Komplex (T* GTP - PDE g ) entstanden.
PDE a-b, also die enzymatisch aktive Phosphodiesterase (PDE*), ist nun
in der Lage, 2000 cGMP-Moleküle in 5´GMP umzuwandeln, und damit den cGMP-Spiegel
zu senken. Dies führt zum Verschluß von Na+/Ca2+- Kanälen, wodurch die
Zelle hyperpolarisiert und keine Transmitter mehr ausschüttet, also abgeschaltet
ist.
Transducin regeneriert sich in der Art und Weise, daß der T*-GTP-PDE
g -Komplex nach einer Zeit das GTP in GDP umwandelt und sich nun mit der
T b-g -Untereinheit zusammenlagert, wobei PDE g abfällt und nun mit der
PDE* (PDE a-b) und sich wieder zu inaktiever PDE zusammenlagert.
 |
Abb.3:
Die drei Reaktionszyklen im Detail. grüne Pfeile: Aktivierungsschritte;
rötliche Pfeile: Inaktivierungs- u. Regenerationsschritte
aus:"Signaltransduktion in Sehzellen", F.
Müller & U. B. Kaupp in Naturwissenschaften 85, 49-61 (1998) Springer
|
|
| top |
Die
Erholungsphase |
|
|
Ist der Lichtreiz vorbei, werden nun alle aktivierten Enzyme der Kaskade
schnell wieder regeneriert und der niedrige cGMP-Spiegel wird von einer
cGMP-synthetisierenden Guanylylzyklase wieder auf altes Niveau gebracht.
Dies wird über den Ca2+-Spiegel gesteuert. Sind nämlich die Na+/Ca2+-
Kanäle offen, wie das bei Dunkelheit der Fall ist, so ist der Ca2+- Spiegel
hoch. Sind sie geschlossen, strömt kein Ca2+ mehr in die Zelle und der
ständig aktive Ca2+- Austauscher befördert Ca2+ aus der Zelle heraus,
sodaß die Ca2+- Konzentration sinkt. Die Guanylylzyklase wird nun von
einem Guanylylzyklase-aktivierenden-Enzym (GCAP) aktiviert und die GCAP
ist Ca2+- abhänig. Bindet nämlich Ca2+ an GCAP, - dies ist bei hoher Ca2+-
Konzentration der Fall, also bei offenen Na+/Ca2+- Kanälen und Dunkelheit
- , so ist die GCAP inaktiv und gleichzeitig auch die Guanylylzyklase.
Das ist auch logisch, denn wenn die Na+/Ca2+- Kanäle offen sind, heißt
das auch, daß genügend cGMP in der Zelle vorhanden ist, da es ja die Kanäle
offen hält.
Ist die Ca2+- Konzentration niedrig, wie es bei geschlossenen Kanälen
und einem Lichtreiz der Fall ist, löst sich Ca2+ vom GCAP, welches dadurch
aktiviert wird und gleichzeitig auch die Guanylylzyklase aktiviert. Die
Guanylylzyklase synthetisiert nun cGMP, sodas dessen Konzentration wieder
steigt und der Dunkelstrom wieder fließt.
 |
Abb. 4:
Wechselseitige Kontrolle von cGMP-Zyklus und Ca2+-Zyklus aus:"Signaltransduktion
in Sehzellen", F. Müller & U. B. Kaupp in Naturwissenschaften 85,
49-61 (1998) Springer |
|
| top |
Unterschiede
zwischen Stäbchen und Zapfen |
|
|
In der Einleitung wurde gesagt, daß die Art und Weise, wie Stäbchen und
Zapfen auf einen Lichtreiz reagieren, prinzipiell gleich ist. In Zapfen
werden Isoformen der Signaltransduktionskaskade, - wie Opsin, Transducin
und die Phosphodiesterase -, verwendet, die auch in den Stäbchen vorkommen,
allerdings leichte charakteristische Unterschiede in der Aminosäuresequenz
aufweisen. Die Aktivierungskinetik und die Verstärkung der Enzymkaskade
sind ebenfalls gleich. Bei gleichen molekularen Eigenschaften läßt sich
dennoch ein wichtiger und entscheidender Unterschied in der Geschwindigkeit
der Lichtaktivierung (Lichtantwort) und der Lichtempfindlichkeit feststellen.
Es könnte sein, daß die intrazelluläre Ca2+-Konzentration und deren Änderung
durch Licht für die unterschiedlichen Reaktionen verantwortlich ist, da
Ca2+ auch eine Rolle bei der Adaptation spielt. Darüber ist aber bisher
wenig bekannt.
In den letzten 30 Jahren sind verbesserte Methoden entwickelt worden,
um elektrische Potentiale einzelner Photorezeptoren ableiten zu können.
Die Registrierung elektrischer Zellaktivität wird heutzutage mit Hilfe
von Mikroelektroden (Patch-clamp-Technik) vorgenommen. Auf diese Weise
ist sogar das Signal direkt zu beobachten, welches durch Absorption eines
einzigen Photons ausgelöst wird. Allgemein wurden folgende Beobachtungen
gemacht:
Das Ruhemembranpotential der Rezeptorzelle beträgt -40 mV. Ein Lichtblitz
bewirkt eine Hyperpolarisierung (s. o.), die von der Intensität des Blitzes
abhängt und mit ihr zunimmt. Eine Sättigung durch sehr helle Blitze ist
bei - 70 mV erreicht. Dann sind alle cGMP-abhängigen Na+-Kanäle geschlossen,
und eine noch stärkere Hyper- polarisierung ist nicht möglich.
A. Zimmerman sowie L. Haynes und K.-W. Yau zeigten, daß der Strom, der
durch einen Na+-Kanal fließt, eine Million Ionen pro Sekunde überschreiten
kann. Hierzu wurde ein Stück aus der Stäbchenmembran eines Salamanders
mit einer cGMP-haltigen Lösung behandelt, während das Membranpotential
im Dunkeln künstlich hyperpolarisiert wurde. In der Abb. 5 ist zu erkennen,
daß ein meßbarer elektrischer Strom von etwa 1 pA Stärke resultiert, wenn
sich ein Na+-Kanal öffnet. Wenn zwei Kanäle gleichzeitig geöffnet sind,
resultiert ein Gesamtstrom von 2 pA. Die Ströme verhalten sich also additiv
zueinander. Gleichzeitig läßt sich erkennen, das nur ganzzahlige Vielfache,
also Ströme von 1, 2, 3 pA usw. auftreten können, jedoch kein Strom von
2,5 pA.
 |
Abb. 5:
Stromfluß bei einem (1. gestrichelte Linie) bzw. zwei (2. gestrichelte
Linie) gleichzeitig geöffneten Kanälen.
aus:"Die Reaktion von Photorezeptoren auf Licht, J.L.Schnapf & D.A.
Baylor in "Physiologie der Sinne", H.P. Zenner & E. Zrenner Spektrum
der Wissenschaften - Verständliche Forschung 1994 |
|
| top |
a)
Lichtempfindlichkeit |
|
|
Stäbchen und Zapfen zeigen einen ersten Unterscheid bei der Reaktion auf
einzelne Photonen. Bei entsprechenden Bedingungen vermag ein Stäbchen
in der menschlichen Netzhaut noch zu melden, daß ein einzelnes Photon
absorbiert worden ist, obwohl dadurch lediglich ein einziges der rund
100 Mio. Rhodopsin-Moleküle in dem Stäbchen aktiviert worden ist. Als
Indikator für die Stäbchenantwort wird der Photostrom bei Lichteinfall
verwendet. Das Stäbchen wird wiederholt mit einem so schwachen Lichtblitz
belichtet, daß dieser im Mittel ein Rhodopsin-Molekül aktiviert. Der resultierende
Photostrom schwankt zwischen Werten nahe null und 1-3 pA. Diese Schwankung
resultiert aus der zufallsbedingten Photonen-Emission der Lichtquelle.
Eine statistische Analyse zeigt, daß die Antwort von 1 pA durch die Aktivierung
eines einzelnen Rhodopsin-Moleküls ausgelöst wird. Zu bedenken ist jedoch,
daß selbst in völliger Dunkelheit Stäbchen gelegentlich ein Signal abgeben
wie nach Absorption eines Photons. Dies liegt daran, daß die Rhodopsin-Moleküle
auch thermisch aktiviert werden können. Diese Reize werden ebenso vom
Sehsystem wahrgenommen und bei völliger Dunkelheit als sehr schwaches
Licht registriert - dieses Phänomen wird "Eigengrau" genannt. Abb. 6 zeigt
diese vorgenannten Sachverhalte. Zu bedenken ist, daß durch den Lichtblitz
eine Reduktion des Dunkelstroms von 40 pA um 1-3 pA erzielt wird.
 |
Abb. 6:
Antwort eines Stäbchens auf ein einzelnes Photon
aus:"Die Reaktion von Photorezeptoren auf Licht,
J.L.Schnapf & D.A. Baylor in "Physiologie der Sinne", H.P. Zenner
& E. Zrenner Spektrum der Wissenschaften - Verständliche Forschung
1994 |
Die Antwort eines Zapfens auf ein einzelnes Photon kann nicht gemessen
werden, da sie zu schwach ist und im Hintergrundrauschen untergeht. Es
wird aber vermutet, daß ein absorbiertes Photon einen Photostrom von etwa
10 fA in einem Zapfen erzeugt. Dies entspricht nur etwa einem Hundertstel
der Lichtempfindlichkeit eines Stäbchens. Dieser charakteristische Unterschied
hilft erklären, warum die Zapfen bei Helligkeit weniger empfindlich reagieren
als die Stäbchen in der Dämmerung. In dunkeladaptierten Stäbchen ist die
Lichtempfindlichkeit durch lange Lebensdauer der Enzyme und enge Koppelung
der drei Zyklen maximiert.
|
| top |
b)
Lichtantwort (Geschwindigkeit der Lichtaktivierung ) |
|
|
Was die Reaktionsgeschwindigkeit von Zapfen und Stäbchen angeht, verhält
sich diese genau umgekehrt zur Lichtempfindlichkeit. Die Zapfen sind zwar
viel lichtunempfindlicher als die Stäbchen, dafür reagieren sie auf ein
Photon aber ungefähr viermal so schnell. In Abb. 7 stellen die beiden
Diagramme den Stromfluß am Außensegment als Funktion der Zeit nach einem
Blitz dar, der jeweils für beide Rezeptortypen gleich intensiv war. Die
Intensität wurde fortschreitend bis zur Lichtsättigung und damit dem Schließen
aller Na+-Kanäle verdoppelt. Zu diesem Zeitpunkt hört der einwärts gerichtete
Strom vollständig auf. Halbmaximale Antworten wurden bei den Stäbchen
durch 30 aktivierte Rhodopsin-Moleküle erreicht, bei den Zapfen durch
1200 aktivierte Rhodopsin-Moleküle. Bei einem Menschen beispielsweise
kann ein Stäbchen erst nach 300 ms signalisieren, daß ein Photon absorbiert
worden ist. Dagegen benötigen die schnellen Lichtanworten der Zapfen nur
wenige ms.
 |
Abb. 7:
Membranströme nach Belichtung durch Lichtblitze verschiedener Intensität
oben: Stäbchen unten: Zapfen
aus:"Die Reaktion von Photorezeptoren auf Licht, J.L.Schnapf & D.A.
Baylor in "Physiologie der Sinne", H.P. Zenner & E. Zrenner Spektrum
der Wissenschaften - Verständliche Forschung 1994 |
Abschließend läßt sich folgendes sagen: die Zapfen reagieren auf ein
Photon rasch und schwach, wenn das Beleuchtungsniveau hoch ist und die
Zapfen sozusagen lichtgesättigt sind; dann kann das Sehsystem schnelle
Veränderungen der Intensität und des betrachteten Objektes ermitteln.
Die langsameren und höheren Antworten der Stäbchen wiederum sind besonders
günstig für das Zählen von Photonen, wenn das Beleuchtungsniveau niedrig
ist. Es scheint also demnach ein Kompromiß zwischen Empfindlichkeit und
zeitlicher Auflösung geschlossen zu werden.
|
| top |
Lichtspektrum
und Farbensehen |
|
|
Sichtbares Licht wird sowohl vom Menschen als auch vom Makaken im Wellenlängenbereich
von 400 - 750 nm wahrgenommen. Oberhalb 750 nm (nahes Infrarot) reicht
die Lichtenergie nicht aus, um die Isomerisierung vom 11-cis-Retinal in
das all-trans-Retinal durchzuführen. Unterhalb 400 nm (nahes Ultraviolett)
könnte das Licht zwar vom Rhodopsin absorbiert werden, die Photonen werden
allerdings schon von Cornea und Linse aufgenommen.
In der Netzhaut des Makaken sind drei Arten von Zapfen zu finden. Die
Zapfen sind dadurch charakterisiert, daß sie Sehpigmente besitzen, die
unterschiedlich auf Licht verschiedener Wellenlänge ansprechen. Dies ist
auf den Proteinanteil des Sehpigments, das sogenannte Opsin, zurückzuführen,
welcher bei den unterschiedlichen Zapfentypen vom Aufbau her geringfügig
variiert. So wird eine maximale Absorption in verschiedenen Wellenlängenbereichen
des sichtbaren Spektrums erreicht. Dies ist die Grundlage für das Farbensehen.
Blaue Zapfen haben ein Empfindlichkeitsmaximum bei etwa 430 nm, grüne
Zapfen bei 530 nm und rote Zapfen bei 560 nm. Die Stäbchen weisen ein
Empfindlichkeitsmaximum bei ungefähr 490 nm auf, also im Blau-Grün-Bereich
des Spektrums.
 |
Abb. 8:
Relative Empfindlichkeit von Stäbchen und Zapfen des Makaken gegenüber
Photonen verschiedener Wellenlänge. Schwarz: Stäbchenspektrum; farbig:
Zapfenspektren (blau, grün, rot)
aus:"Die Reaktion von Photorezeptoren auf Licht, J.L.Schnapf & D.A.
Baylor in "Physiologie der Sinne", H.P. Zenner & E. Zrenner Spektrum
der Wissenschaften - Verständliche Forschung 1994 |
Aus der Abb. 8 ist ersichtlich, daß jeder Zapfentyp für einen breiten
Wellenlängenbereich empfindlich ist, - wenn auch unterschiedlich stark
-, und die entsprechenden Bereiche der Zapfentypen einander überlappen.
Indem das Sehsystem das Verhältnis der Erregungen zueinander wahrnimmt,
vermag es aus der Wellenlänge die Farbe zu berechnen. Die drei verschiedenen
Zapfentypen bewirken die sogenannte Trichromasie des Farbensehens. Sind
alle drei Zapfentypen im gleichen Maße am Zustandekommen der Erregung
beteiligt, so entsteht die Empfindung "Unbunt" (Weiß).
|