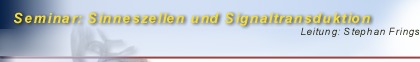 |
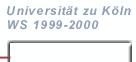 |
 |
Die ungewöhnliche Sehkaskade des parietalen Auges der EidechsenMessungen des Stromflusses in den Parietalaugen der Eidechsen ergaben sensationelle Neuigkeiten und zeigten interessante Unterschiede zu den lateralen Augen der Vertebraten auf, von denen bereits vorher ausführlich berichtet worden ist. In Dunkelheit erfolgt hier keine Dauerdepolarisation, sondern sie wird erst durch einen Lichtreiz induziert. Die dafür verantwortliche Sehkaskade konnte als ebenfalls cGMP abhängig nachgewiesen werden, was dem Aufbau beim lateralen Augentyp entspricht. Die Synthese des cGMP erfolgt über eine Guanylycyclase, die in geringen Mengen cGMP darstellt, welches dann zur Regulation von einer Phosphodiesterase (PDE) abgebaut wird. Lichtreize bewirken eine Hemmung der PDE, wodurch die cGMP-Konzentration in den Zellen ansteigt und ein Öffnen der cGMP-abhängigen Ionenkanäle erfolgt. Es entsteht eine Depolarisation und der Lichtreiz wird wahrgenommen. |
 |
Inhaltsverzeichnis:
![]() Transduktion
Transduktion
![]() cGMP-Abhängigkeit
cGMP-Abhängigkeit
![]() Lichteinfluß
Lichteinfluß
![]() IBMX-1
IBMX-1
![]() IBMX-2
IBMX-2
![]() Lichthemmung
der PDE
Lichthemmung
der PDE
![]() Sehkaskade
Sehkaskade
| Um die Sehkaskade genauer und anschaulich
darzustellen, werden anhand von Beispielexperimenten die Vorgehensweise
der Entdeckung Schritt für Schritt durchgegangen und erklärt. Es wird dadurch
einfacher die einzelnen Instanzen der Sehkaskade zu verstehen und nachzuvollziehen!
Während der Untersuchungen der Parietalaugen wurde eine sensationelle Entdeckung
gemacht. Als sie die Potentialdiffernz der Nervenfasern ableiteten, stellten
sie fest, daß sich die Zellen im Zustand des Ruhepotentials befanden. Es
erfolgte also nicht, wie bei den lateralen Augen der Vertebraten eine Dauerdepolarisation,
sondern erst nach Lichtreizung konnte ein meßbarer Stromfluß (Depolarisation)
beobachtet werden. Die anschließende Untersuchung der Anatomie dieses Augentypus
ergab keine Besonderheiten. Sie unterschieden sich nicht grundlegend von
der der lateralen Augen. Sie besaßen eine Cornea, eine Linse und eine Retina.
Die Retina bestand hier aber nur aus Photorezeptoren und Ganglienzellen.
Eine Differenzierung der Zellen in Amakrin-, Bipolar- oder Horizontalzellen
konnte nicht gefunden werden. |
| |
Wie erfolgt nun aber Phototransduktion in den Rezeptorzellen? | ||||||||
|
|
Viele Fragen, denen noch auf den Grund gegangen werden muß: 1) Um die
Frage der cGMP-Abhängikeit bzw. das Vorhandensein von cGMP-abhängigen
Kanälen zu klären, wurden isolierten Retinazellen in Dunkelheit cGMP-Lösungen
unterschiedlicher Konzentrationen injiziert und ein eventueller Stromfluß
gemessen. Sollten nämlich Kanäle vorhanden sein, die eine Depolarisation
und dadurch einen Stromfluß bewirken, die cGMP-abhängig sind (in Anlehnung
an den lateralen Augentyp), so sollte ein Ansteig der Konzentration in
den isolierten Zellen eine meßbare Potentialdifferenz bewirken.
|
||||||||
| top | Woran könnte dies gelegen haben? | ||||||||
|
|
|
||||||||
| top |
Aber welchen genauen Einfluß hat das Licht auf die Depolarisation? |
||||||||
|
|
Wie bereits nachgewiesen worden ist, öffnet cGMP die Ionenkanäle und induziert dadurch eine Depolarisation, wobei eine höhere Konzentration auch eine höhere Potentialdifferenz auslöst. Analog der Sehkaskade bei lateralen Augen der Vertebraten ließe sich spekulieren, daß die Regulation über eine Guanylylcyclase und eine Phosphodiesterase funktioniert. Den Nachweis einer PDE läßt sich sehr leicht führen, in dem man einen spezifischen PDE-Inhibitor hinzugibt, wodurch die Aktivität der PDE negativ beeinflußt wird. Verwendbar hierfür wäre die Substanz 3-Isobutyl-1-methyl-xanthin, abgekürzt IBMX. Bei IBMX handelt es sich um ein Molekül, daß sehr permeabel für die Zellmembrane ist und dadurch leicht in die Zellen gelangen kann.
|
||||||||
| top | Aber was könnte nach Zugabe von IBMX passieren? | ||||||||
|
|
Das nachfolgende Diagramm zeigt das erhaltenen Ergebnis:
Wie bereits ersichtlich ist, löst IBMX eine enorme Potentialdifferenz aus, die einer Lichtreizreaktion sehr ähnlich ist (unteres Diagramm):
Würde Licht die Guanylycyclase aktivieren oder verstärken, so müßte die Potentialdifferenz bei IBMX-Zugabe und sofortiger Lichtbestrahlung (Lichtblitz) isolierter Zellen noch weiter ansteigen. Die folgenden Diagramme geben Aufschluß über das Ergebnis:
|
||||||||
| top | Was passiert nun aber, wenn die Zeitabstände von IBMX-Zugabe und Lichtblitz vergrößert werden? | ||||||||
|
|
Wunderbar läßt sich erkennen, daß Licht wirklich einen Einfluß auf
das Geschehen ausübt (dies war aber auch schon vorher sichergestellt),
aber überhaupt keinen auf die Guanylylcyclase. Betrachten wir erst einmal die erhaltenen Werte für die Konzentrationen
von 50 und 10µmol cGMP:
|
||||||||
| top | Aber wie macht es das? | ||||||||
|
|
Es läßt sich wunderbar erkennen, daß die Lichtblitze keinerlei Wirkung
erzielen, die Phosphodiesterase also eine solch hohe Aktivität besitzt,
daß die cGMP-Moleküle rasend schnell abgebaut werden und nicht in der
Lage sind die Ionenkanäle zu öffnen.
|
||||||||
| top | Wie sieht die Sehkaskade nun aber aus? | ||||||||
|
Daraus ergibt sich folgende Sehkaskade:
|