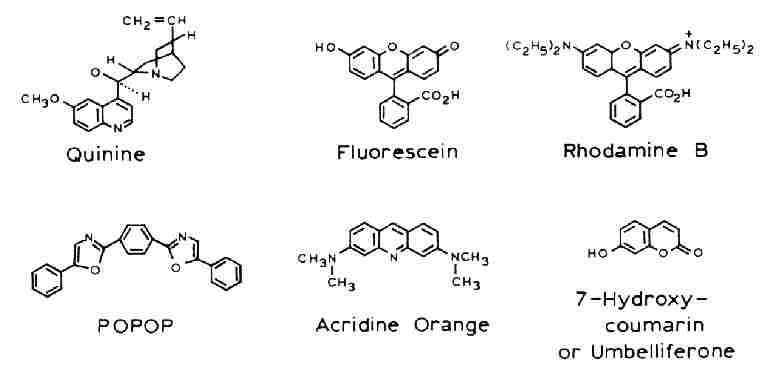Die Prozesse, die von der Absorption von Anregungslicht zur Emission von Fluoreszenzlicht führen, werden oft
mit Hilfe von Energiediagrammen dargestellt, die nach dem polnischen Physiker Alexander Jablonski benannt sind, dem
Begründer der modernen Fluoreszenzspektroskopie.
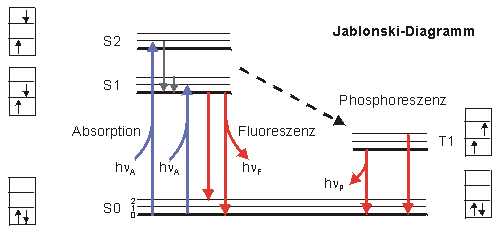 Ein Jablonski-Diagramm zeigt die Energien der Elektronenübergänge, die bei Absorption und Emission von
Photonen auftreten. Viele Fluorochrome haben aromatische Ringstrukturen (siehe unten). Solche Moleküle
besitzen delokalisierte Elektronen in sogenannten bindenden p-Orbitalen. Die Elektronen dieser Orbitale
treten leicht in Wechselwirkung mit der Umgebung und erreichen bei Absorption eines Anregungsphotons in höheres
Orbital (p*). In bindenden Orbitalen liegen Elektronen normalerweise mit antiparallelem Spin
vor - eine Anordnung, die die sogenannten Singulett-Zustände charakterisiert (S0, S1, S2). Die Absorption
eines Anregungsphotons (hnA) hebt ein Elektron aus dem Grundzustand S0 in
einen der angeregten Zustände S1 oder S2. Dieser Vorgang ist extrem schnell, er vollzieht sich
innerhalb etwa 10-15 s. Aus dem oberen angeregten Zustand ist ein Übergang nach S1 möglich, ohne
das eine Photon emittiert wird ("innere Umwandlung"), aber beim Übergang in den Grundzustand wird die
freiwerdende Energie als Fluoreszenzphoton (hnF) emittiert. Die Energie des
emittierten Photons ist immer geringer als die des absorbierten Photons - damit ist die Wellenlänge des Fluoreszenzlichts
größer als die des Anregungslichts (Stokessche Regel). Die mittlere Verweilzeit im angeregten Zustand (Fluoreszenz-Lebenszeit)
ist bei vielen Fluorochromen im Bereich von 10 ns.
Ein Jablonski-Diagramm zeigt die Energien der Elektronenübergänge, die bei Absorption und Emission von
Photonen auftreten. Viele Fluorochrome haben aromatische Ringstrukturen (siehe unten). Solche Moleküle
besitzen delokalisierte Elektronen in sogenannten bindenden p-Orbitalen. Die Elektronen dieser Orbitale
treten leicht in Wechselwirkung mit der Umgebung und erreichen bei Absorption eines Anregungsphotons in höheres
Orbital (p*). In bindenden Orbitalen liegen Elektronen normalerweise mit antiparallelem Spin
vor - eine Anordnung, die die sogenannten Singulett-Zustände charakterisiert (S0, S1, S2). Die Absorption
eines Anregungsphotons (hnA) hebt ein Elektron aus dem Grundzustand S0 in
einen der angeregten Zustände S1 oder S2. Dieser Vorgang ist extrem schnell, er vollzieht sich
innerhalb etwa 10-15 s. Aus dem oberen angeregten Zustand ist ein Übergang nach S1 möglich, ohne
das eine Photon emittiert wird ("innere Umwandlung"), aber beim Übergang in den Grundzustand wird die
freiwerdende Energie als Fluoreszenzphoton (hnF) emittiert. Die Energie des
emittierten Photons ist immer geringer als die des absorbierten Photons - damit ist die Wellenlänge des Fluoreszenzlichts
größer als die des Anregungslichts (Stokessche Regel). Die mittlere Verweilzeit im angeregten Zustand (Fluoreszenz-Lebenszeit)
ist bei vielen Fluorochromen im Bereich von 10 ns.
Bei manchen Verbindungen kann es zu einem Übergang aus einem angeregten Singulettzustand in einen Triplett-Zustand (T1) kommen.
Bei diesem Vorgang ("Interkombination") kommt es zu einer Spinumkehr des angeregten Elektron, und auch der Sprung in den Grundzustand
erfordert eine Spinumkehr. Solche Vorgänge sind jedoch sehr unwahrscheinlich, und die Emissionsraten sind sehr gering
(1-1000 pro s). Diese geringe Übergangsrate ist der Grund für das langsame Abklingen der Phosphoreszenz bei
Leuchtziffern und Spielzeug, das im Dunkeln leuchtet.
|


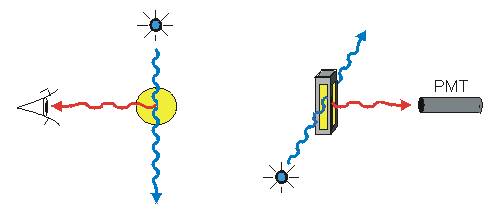
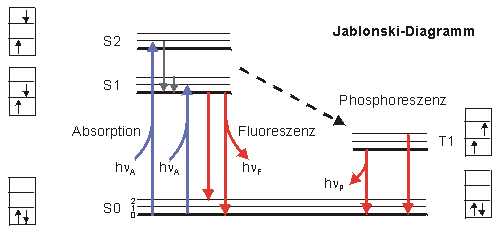 Ein Jablonski-Diagramm zeigt die Energien der Elektronenübergänge, die bei Absorption und Emission von
Photonen auftreten. Viele Fluorochrome haben aromatische Ringstrukturen (siehe unten). Solche Moleküle
besitzen delokalisierte Elektronen in sogenannten bindenden p-Orbitalen. Die Elektronen dieser Orbitale
treten leicht in Wechselwirkung mit der Umgebung und erreichen bei Absorption eines Anregungsphotons in höheres
Orbital (p*). In bindenden Orbitalen liegen Elektronen normalerweise mit antiparallelem Spin
vor - eine Anordnung, die die sogenannten Singulett-Zustände charakterisiert (S0, S1, S2). Die Absorption
eines Anregungsphotons (hnA) hebt ein Elektron aus dem Grundzustand S0 in
einen der angeregten Zustände S1 oder S2. Dieser Vorgang ist extrem schnell, er vollzieht sich
innerhalb etwa 10-15 s. Aus dem oberen angeregten Zustand ist ein Übergang nach S1 möglich, ohne
das eine Photon emittiert wird ("innere Umwandlung"), aber beim Übergang in den Grundzustand wird die
freiwerdende Energie als Fluoreszenzphoton (hnF) emittiert. Die Energie des
emittierten Photons ist immer geringer als die des absorbierten Photons - damit ist die Wellenlänge des Fluoreszenzlichts
größer als die des Anregungslichts (Stokessche Regel). Die mittlere Verweilzeit im angeregten Zustand (Fluoreszenz-Lebenszeit)
ist bei vielen Fluorochromen im Bereich von 10 ns.
Ein Jablonski-Diagramm zeigt die Energien der Elektronenübergänge, die bei Absorption und Emission von
Photonen auftreten. Viele Fluorochrome haben aromatische Ringstrukturen (siehe unten). Solche Moleküle
besitzen delokalisierte Elektronen in sogenannten bindenden p-Orbitalen. Die Elektronen dieser Orbitale
treten leicht in Wechselwirkung mit der Umgebung und erreichen bei Absorption eines Anregungsphotons in höheres
Orbital (p*). In bindenden Orbitalen liegen Elektronen normalerweise mit antiparallelem Spin
vor - eine Anordnung, die die sogenannten Singulett-Zustände charakterisiert (S0, S1, S2). Die Absorption
eines Anregungsphotons (hnA) hebt ein Elektron aus dem Grundzustand S0 in
einen der angeregten Zustände S1 oder S2. Dieser Vorgang ist extrem schnell, er vollzieht sich
innerhalb etwa 10-15 s. Aus dem oberen angeregten Zustand ist ein Übergang nach S1 möglich, ohne
das eine Photon emittiert wird ("innere Umwandlung"), aber beim Übergang in den Grundzustand wird die
freiwerdende Energie als Fluoreszenzphoton (hnF) emittiert. Die Energie des
emittierten Photons ist immer geringer als die des absorbierten Photons - damit ist die Wellenlänge des Fluoreszenzlichts
größer als die des Anregungslichts (Stokessche Regel). Die mittlere Verweilzeit im angeregten Zustand (Fluoreszenz-Lebenszeit)
ist bei vielen Fluorochromen im Bereich von 10 ns.