|
|
Bei praktisch alle peripheren Analgetika handelt es sind um Säuren; besitzen
analgetische, antipyretische und antiphlogistische Eigenschaften.
- Wirkstoffe
- Salicylate (z.B. ASS*, Diflunisal)
- Phenyl- und Heteroarylessigsäuren (z.B. Diclofenac, Indometacin)
- a-Arylpropionsäuren (z.B. Ibuprofen*, Ketoprofen)
- Pyrazolone* (z.B. Phenylbutazon)
- Oxicame (z.B. Meoxicam, Piroxicam) nichtsaure, periphere Analgetika:
- p-Aminophenole ( z.B. Paracetamol*)
- Pyrazolone* (z.B. Propypeneazon, Metamizol, Phenazon) *freikäuflich
- Wirkung am Beispiel von ASS
- Hemmung der Cyclolxygenase druch Acetylsalicylsäure: ASS Azetyliert
das Enzym wodurch zu einer Hemmung des aktiven Zentrums kommt
- Cyclooxygenase -> Schlüsselenzym bei der Biosynthese verschiedener
Entzündungs- und Schmerzmediatoren; katalysiert die Umsetzung von
Arachidonsäure der Zellmembran zu Prostaglandinen, Prostazyklin
und Thromboxanen
- Nebenwirkungen der peripheren Analgetika
- Gastrointestinale Unverträglichkeit,
- Hautreaktionen
- ZNS-Reaktionen; Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerz
- Leberreaktionen
- Blutbildveränderung
- allergische Reaktionen
- Natrium- und Wasserretention der Niere
|
|
|
- Opiate:
- Opium ein Extrakt des Schlafmohns (Papaver somniferum)
- Wirkung schon ca. 4000 vor Chr. bekannt
- bereits in der Antike eingesetzt bei: Kopfschmerzen, Gallenblasenbeschwerden
usw.
- 1806 isoliert SERTÜRNER Morphin (nach Morpheus, dem griechischen
Gott der Träume, benannt)
- Heroin -> einfaches Derivat des Morphins, dem lediglich zwei
Acetylgruppen zugefügt wurden, tritt schneller in das Gehirn über,
da die Acetylgruppen die Fettlöslichkeit erhöhen (rascherer Rauschzustand)
- Opiatwirkung:
- Erforschung der Wirkung begann mit der
Lokalisation der Schaltstelle, an der das Pharmakon die nachfolgenden
Stoffwechselveränderungen in Gang setzt
- für spezifische Proteinrezeptoren sprach:
-> hohe Wirkungsstärke der Opiate bei kleinsten Dosen und ->
das Auftreten von Opiatantagonisten, die in der Lage sind die Opiatwirkung
in kürzester Zeit aufzuheben, was zu der Vorstellung paßte, daß
diese von den Antagonisten von ihren Rezeptoren verdrängt würden.
- Agonist: Ein Agonist kann also als ein
Pharmakon betrachtet werden, dessen Wechselwirkung mit dem Rezeptor
eine Folge von Ereignissen auslöst, die die Zellfunktion verändern
- Antagonist: ähnliche chemische Struktur
wie Agonist, hat keine physiologischen Effekte; blockiert vielmehr
selektiv und effektiv jede weitere Aktivität des Agonisten
- 1973: Nachweis von Opiat-Rezeptoren mit Hilfe
von radioaktiv-markiertem Naloxon w partielle Agonisten/Anagonisten
die Natriumbindungstheorie
- Lokalisation der Opiat-Rezeptoren mit Hilfe
von radioaktiv markierten Opiaten, die Ratten intravenös injiziert wurden
- Areale mit hoher Rezeptordichten: Übereinstimmung
der Funktionen dieser Hirnstrukturen mit den wichtigsten pharmakologischen
Wirkungen:
| Lokalisation und mögliche Funktion von Opiatrezeptoren
(in Auszügen) |
| Ort |
durch Opiate beeinflußbare Funktionen |
| Rückenmark Laminae I und II (Substantia gelatinosa) |
Wahrnehmung von Schmerzen auf der Ebene des Rückenmarks |
| Hirnstamm Substantia gelantinosa des Spinaltraktes des caudalen
Trigeminus |
Wahrnehmung von Schmerzen im Kopf |
Kern des Tractus solitarius,
Nucleus commissuralis Nucleus ambiguus |
Vagusreflex, Atemdepression, Hustendepression,
Orthostase-Syndrom,
Hemmung der Magensekretion |
| Locus coeruleus |
Euphorie |
| prätektales Gebiet |
Verengung der Pupille (Miosis) |
Dinecephalon lateraler Teil des medialen Thalamuskerns,
innere und äußere thalamische Laminae, intralaminare Kerne,
Nucleus periventricularis thalami |
Schmerzwahrnehmung |
| Telencephalon Amygdala |
emotionale Effekte |
| Subfornicalorgan |
Hormoneffekte |
| |
(nach Snyder 1994) |
- 1975: Isolierung der Enkephline als körpereigene
Neurotransmitter der Opiatrezeptoren durch HUGHES und KOSTERLITZ
- im heutigen Gebrauch sind Enkephaline jedoch
nur die beiden von HUGHES und KOSTERLITZ isolierten Peptide, als Bezeichnung
für endogene morphinähnliche Substanzen wurde der Begriff Endorphine
gebildet
- Entwicklung von suchtfreien Schmerzmitteln
mit Hilfe von Endorphine bis jetzt ohne Erfolg
- Opiatsucht:
- Suchtentwicklung in 3 Stufen:
- Toleranz: Zustand, der immer höhere
Dosen erfordert, um die anfänglich durch eine viel geringere
Dosis auslösbaren Wirkungen hervorzurufen
- Körperliche Abhängigkeit: Zustand
bei dem durch plötzliches Absetzten schwere körperliche Entzugserscheinungen
auftreten; von gegenteiligem Charakter der Wirkung des Pharmakon;
bei Morphin: Depression, Übererregbarkeit und Überempfindlichkeit
gegenüber Schmerzreizen
- Zwanghafte Drogensucht: gekennzeichnet
durch Rückfall trotz langem Entzug in geschlossener Anstalt
mit sozialer und beruflicher Rehabilitation; sowohl die Möglichkeit
eines soziologischen Phänomens aus auch ein biologischer Hintergrund
mit physischen Veränderungen wird nicht ausgeschlossen
- Opioidrezeptoren:
- drei Opioidrezeptoren sind bekannt: µ,
k und d, die unterschiedliche, hauptsächlich zentrale Wirkungen
auslösen
- Ihren Namen leiten sich von den Namen der
Substanzen ab, die zur jeweiligen Identifizierung der Wirkung führten
(z.B. µ für Morphin, k für Ketocyclacocin)
- Unterteilung der Opioide in 3 Gruppen nach
ihrer Wirkung am Rezeptor:
- Agonisten ( z.B. Morphin) üben die
ihre Wirkungen hauptsächlich am µ-Rezeptor aus
- Antagonisten wie Naloxon ohne jede
agonistische Wirkung an allen Rezeptoren
- "Mischtyp" mit partieller agonistischer
und gleichzeitig antagonistischer Wirkung w
- Hieraus ergeben sich für die wichtigsten
Wirksubstanzen folgende Selektionen der Wirkungen:
Nalorphin antagon agon + -
| Wirksubstanz: |
µ-Rezeptor: |
k-Rezeptor: |
d-Rezeptor: |
| Morphin |
agon ++ |
agon + |
agon + |
| Fentanyl |
agon +++ |
agon + |
agon + |
| Pentazocin |
antagon |
agon ++ |
- |
| Nalbuphin |
antagon |
agon ++ |
- |
| Buprenorphin |
agon |
antagon |
- |
| Nalorphin |
antagon |
agon + |
- |
| Naloxon |
antagon |
antagon |
antagon |
| (nach Müller-Schwefe 1998) |
- µ-Rezeptoren: Morphin und andere Agonisten
vom Opioidtyp bewirken Analgesie durch Interaktion µ-Rezeptoren. außerdem
Euphorie, Bradykardie, Harnretension, Miosis, körperlicher, Abhängigkeit,
Atemdepression
- k-Rezeptor: Bindung erzeugt ebenfalls Analgesie;
Ligand-Rezeptorbindung hauptsächlich im Rückenmark; geringere Intensität
von Miosis und Atemdepression sowie Effekte der Desorientierung
- d-Rezeptor: Auswirkung der Stimulation dieses
Rezeptors aus Mangel an geeigneten selektiven Liganden nicht mit letzter
Sicherheit festgestellt
- Schwach wirksame Opioide:
- Codein (Metylmorphin)
- Dihydrocodein
- Hydrocodon
- Dextropropoxyphen
- Tramadol
- Tilidin
|
- Stark wirksame Opioide:
- Morphin
- Heroin
- Hydromophon
- Oxycodon
- Methadon
- Pentazocin
|
- Nebenwirkungen von Opioiden:
- Obstipation: Laxanzien als obligate Co-Medikation
- Übelkeit/Erbrechen Sedierung
- Atemdepression
- Toleranzentwicklung
|
|
Quellen und Literatur:
Flöter, T. (Hrsg.) (1998), Grundlagen der Schmerztherapie; Medizin & Wissen
Matthee et al. (1996) Loss of morphin-induced analgesia, reward effect and
withdrawal symptoms in mice laching the µ-opioid-receptor-gene. Nature 383:819-823
Synder, S. H. (1994) Opiate, in: Chemie der Psyche, Spektrum Verlag, Seiten
39-47
top
|
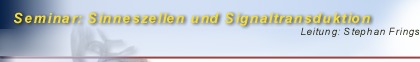
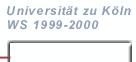


![]() Therapiestufen
Therapiestufen![]() Periphere
Analgetika
Periphere
Analgetika ![]() Zentrale
Analgetika
Zentrale
Analgetika