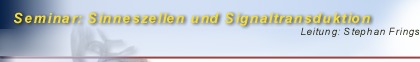 |
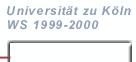 |
 |
Inhaltsverzeichnis: Aufbau und Funktionsprinzipien des OhresDas Ohr empfängt Schallwellen über die Gehörmuschel und leitet diese über das Trommelfell und die Gehörknöchelchen an das Innenohr weiter. Das Innenohr ist unterteilt in das Vestibularsystem (für den Gleichgewichtssinn) und die Cochlea („Hörschnecke", Abb. 1). Diese ist durch das Runde und Ovale Fenster zum Mittelohr hin abgegrenzt und unterteilt in Scala vestibuli, S. tympani und S. media. Erstere sind beide mit Perilymphe gefüllt und stehen am Helicotrema (Ende der Cochlea) miteinander in Verbindung; die dazwuschenliegende S. media (hier Ductus cochlearis genannt) ist mit Endolymphe gefüllt.
|
 |
| |
Aufbau der Cochlea | ||||||
|
|
1. Querschnitt Die Cochlea ist unterteilt in Scala vestibuli, S. tympani und S. media.Erstere
sind beide mit Perilymphe gefüllt und stehen am Helicotrema (Ende der
Cochlea) miteinander in Verbindung; die dazwischenliegende S. media (hier
Ductus cochlearis genannt) ist mit Endolymphe gefüllt.
2. Längsschnitt Die am Runden Fenster eintreffenden Schallwellen wirken auf die Perilymphe ein, so daß die S. media, vor allem die Basilarmembran (BM), in Schwingung versetzt wird. Sie schwingt dabei in Form einer Wanderwelle, was für die Frequenzdiskreminierung von Bedeutung ist.
|
||||||
| top
|
Frequenzdiskreminierung | ||||||
|
|
Die Basilarmembran schwingt in Form einer sogenannten Wanderwelle was mit der Beschaffenheit der Basilarmembran zusammenhängt (Abb. 3):
Die Steife der Basilarmembran nimmt vom Steigbügelfuß zum Helicotrema hin im Verhältnis 10.000 : 1 ab, die Wellen werden dadurch im hinteren Verlauf langsamer (je dichter die Materie, desto schneller die Schallweiterleitung) und die Wellenlängen nehmen ab. Die Amplituden werden durch die höhere Flexibilität jedoch wesentlich größer. Daraus ergibt sich, daß jede Frequenz einen spezifischen Ort auf der Basilarmebran einen Optimalbereich hat, wo die Welle „noch ankommt" und „schon ausschlagen" kann.
|
||||||
| top | Das Corti-Organ | ||||||
|
Es liegen verschiedene Typen von Haarzellen vor: Drei Reihen von äußeren
Haarzellen (ÄHZ) mit etwa 12.000 Zellen und eine Reihe von inneren
(IHZ) mit etwa 3.500. Die ÄHZ sind mit der Tektorialmembran verwachsen,
weden also unmittelbar gereizt, für die IHZ ist dies fraglich.
|
|||||||
| top | Die Äußeren Haarzellen | ||||||
Die ÄHZ übernehmen eine regulatorische Funktion, sie verstärken mechanisch das Reizsignal. Dies wird über eine Kontraktion bewerkstelligt, die synchron mit der Reizung und den dadurch ausgelösten Depolarisationen erfolgt. Sie entsteht durch eine Konformationsänderung eines Transmembranproteins (dessen Struktur noch weitgehend unbekannt ist), dessen Untereinheiten bei einer Hyperpolarisation weiter auseinanderliegen als bei einer Depolarisation. Die Kraft, die diese Proteine bei der Kontraktion erzeugen liegt bei 250 Kilowatt auf ein KG Eigengewicht (Zellen), ein Otto-Motor schafft nichtmals 1 KW .
Bedeutung der Kontraktion: Die Kontraktion schafft eine nicht lineare mechanische Verstärkung, die im Hörschwellenbereich das bis zu 100-fache betragen kann, bei lauten Signalen treten nur noch geringe Verstärkungen auf.
Die ÄHZ oszillieren Reizsynchron, d. h . sie müssen hohe Frequenzen und damit sehr kurze Reizperioden auflösen können. Diese schnelle Reaktionsfähigkeit ist durch die Tip-Links gegeben: die Ionenkanäle werden mechanisch, also mit sehr geringer Zeitverzögerung, geöffnet. Dadurch fehlt aber ein entscheidendes Element: Die sonst häufig vorzufindenden Enzymkaskaden fehlen, und damit auch der Prozeß der Verstärkung (im Auge werden z. B. durch ein Photon, das auf ein Rhodopsinmolekül trifft, 6 Millionen (!) Moleküle cGMP abgebaut). Es mußte also ein Erzatz geschaffen werden, den in der Kontraktionsfähigkeit der ÄHZ verwirklicht sehen kann. |